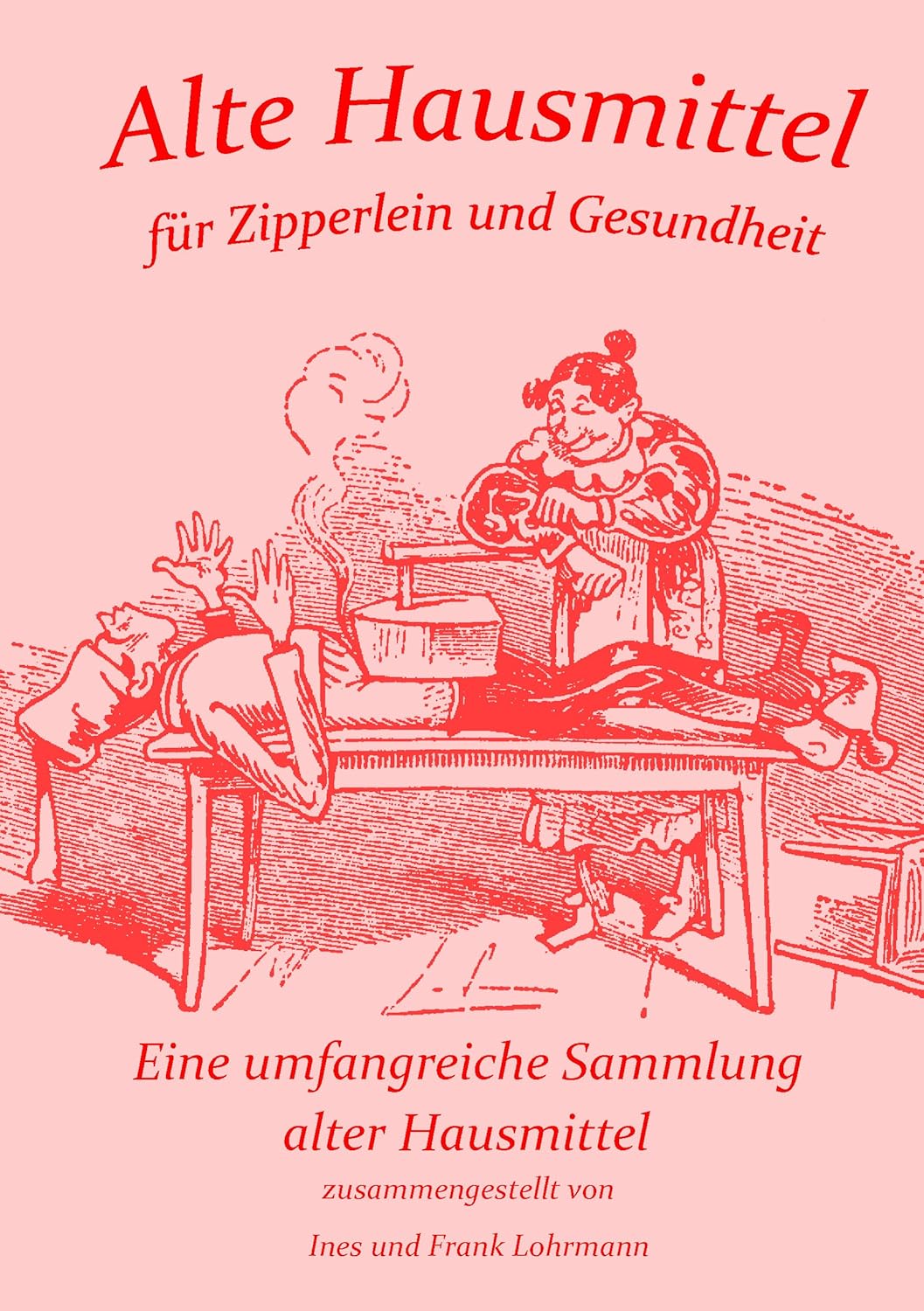Tannenkrebs - Melampsorella caryophyllacearum

Autor: (DC.) J. Schröt. 1874
Synonyme:
Aecidium elatinum Alb. & Schwein. 1805
Caeoma cerastii (Mart.) Schltdl. 1824
Melampsora cerastii G. Winter 1882
Melampsorella caryophyllacearum (DC.) J. Schröt. 1874
Peridermium elatinum Kunze & J.C. Schmidt 1817
Uredo caryophyllacearum DC. 1805
Uredo caryophyllacearum auct.
Uredo cerastii J. Schröt.
Uredo pustulata Pers. 1801
Synonyme:
Aecidium elatinum Alb. & Schwein.
Caeoma caryophyllacearum Link
Caeoma cerastii (Mart.) Schltdl.
Caeoma elatinum (Alb. & Schwein.) Link
Melampsora cerastii (Pers.) G.Winter
Melampsorella caryophyllacearum J.Schröt.
Melampsorella cerasti G.Winter
Melampsorella cerastii (Pers.) J.Schröt.
Melampsoridium caryophyllacearum (J.Schröt.) Blanchette & Biggs
Peridermium elatinum (Alb. & Schwein.) J.C.Schmidt & Kunze
Uredo caryophyllacearum DC.
Uredo cerasti Pers.
Uredo cerastii J.Schröt.
Uredo cerastii Mart.
Uredo pustulata subsp. cerastii Pers.
Uredo pustulata var. cerastii Pers.
Fruchtkörper: Pykniden blattoberseits, unter der Cuticula, kegelig vortretend, honiggelb. Aecidien zu beiden Seiten des Mittelnervs auf der Unterseite der Nadeln in je einer unregelmässigen Reihe, kurz röhrenförmig, mit unregelmässig eingerissenem oder zerfallendem Rande, in der Jugend von der Epidermis bedeckt, blassorange.
Oberfläche, Hülle:
Inneres, Innenmasse:
Basis, Ständer:
Vorkommen: Heteröcisch. Aecidien auf Weiß-Tanne (Abies alba) oder Weißtanne, den Tannenkrebs und Hexenbesen der Weisstanne hervorrufend und perennierend, Uredo- und Teleutosporen auf verschiedenen Arten der Gattung Sternmieren (Stellaria) und Hornkräuter (Cerastium), auf Nabelmieren (Moehringia), Sandkräuter (Arenaria) u.a.
Sporen: Aecidiosporen fast kugelig bis ellipsoidisch, meist etwas polyedrisch, 16—30 µm lang, 14—17 µm breit, dichtwarzig, orangerot. Uredosporenlager klein, gelb, unter der Epidermis und zwar meist unter einer Spaltöffnung entstehend, von einer schliesslich porenförmig sich öffnenden Pseudoperidie bedeckt. Uredosporen fast kugelig bis ellipsoidisch, 20—30 µm lang, 16—24 µm dick, gelborange, dünnwandig, mit weit entfernt stehenden, kurzen, kegeligen Stacheln besetzt. Teleutosporen blattunterseits im Innern der Epidermiszellen, oft in grossen, fast die ganze Unterseite bedeckenden Flecken, weisslich, blassockergelb oder blassfleisch gelb, meist einzellig, zu mehreren bis vielen in jeder Epidermiszelle, oft durch gegenseitigen Druck abgeplattet, so lang, wie die Epidermiszellen hoch, im Durchmesser 14—21 µm.
Eingetragen durch: admin
Zuletzt geändert: Fre , 01.Jan 1971
Für volle Auflösung bitte auf da Bild klicken:
|
|
|
|
Bild 2 © (2) USDA Forest Service - Ogden Archive, USDA Forest Service, Bugwood.org
Bild 3 © (3) Rocky Mountain Research Station/Forest Pathology Archive, USDA Forest Service, Bugwood.org
Bild 4 © (4) USDA Forest Service - Region 2 - Rocky Mountain Region Archive, USDA Forest Service, Bugwood.org