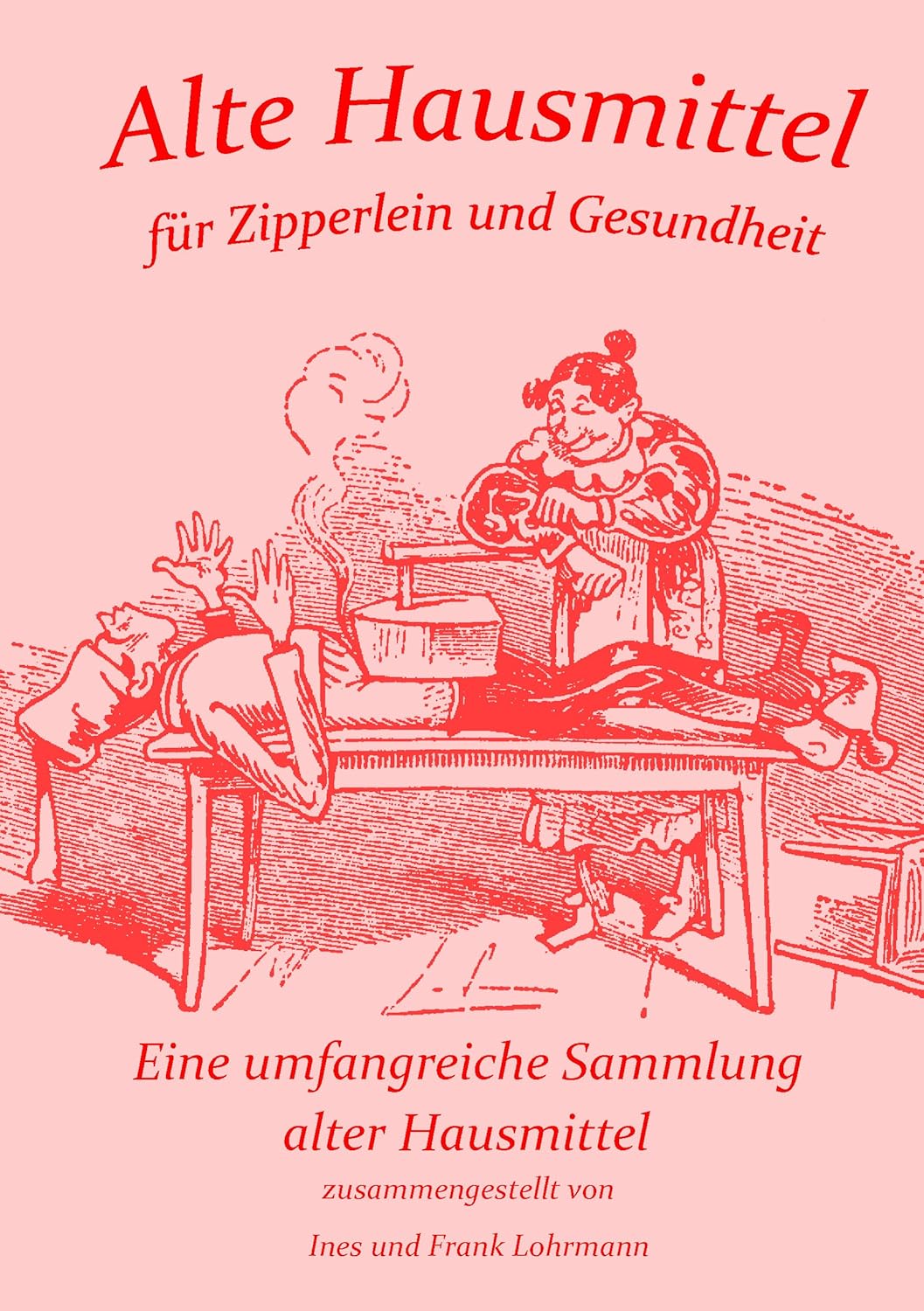Zottiger Schillerporling - Inonotus hispidus
Englisch: Shaggy Bracket

Autor: (Bull.) P.Karst.
Trivialnamen Deutsch:
Boletus hirsutus Scop. 1772
Boletus hirtus Vent. 1812
Boletus hispidus Bull. 1784
Boletus spongiosus Lightf. 1777
Boletus velutinus Sowerby 1797
Boletus villosus Huds. 1778
Hemidiscia hispida (Bull.) Lázaro Ibiza 1916
Inodermus hispidus (Bull.) Quél. 1886
Inonotus hirsutus (Scop.) Murrill 1904
Phaeolus endocrocinus (Berk.) Pat. 1900
Phaeoporus hispidus (Bull.) J. Schröt. 1888
Polyporus endocrocinus Berk. 1847
Polyporus hispidus (Bull.) Fr. 1818
Polystictus hispidus (Bull.) Gillot & Lucand 1890
Xanthochrous hispidus (Bull.) Pat. 1897
Synonyme:
Agaricus velutinus (With.) E.H.L.Krause
Boletus hirsutus Scop.
Boletus hirtus Vent.
Boletus hispidus Bull.
Boletus hispidus var. luteus Bull.
Boletus hispidus var. ruber Bull.
Boletus spongiosus Lightf.
Boletus velutinus Sowerby
Boletus villosus Huds.
Fomes hispidus (Bull.) Maubl.
Hemidiscia hispida (Bull.) Lázaro Ibiza
Inodermus hispidus (Bull.) Quél.
Inonotus hirsutus (Scop.) Murrill
Inonotus hispidus f. quercus (Bourdot & Galzin) Pilát
Inonotus hispidus f. salicum (Bourdot & Galzin) Pilát
Inonotus hispidus var. minor (Rick) Pegler
Inonotus tinctorius (Quél.) S.Ahmad
Phaeolus endocrocinus (Berk.) Pat.
Phaeoporus hispidus (Bull.) J.Schröt.
Placodes tinctorius Quél.
Polyporus endocrocinus Berk.
Polyporus hispidus (Bull.) Fr.
Polyporus hispidus var. minor Rick
Polyporus pollinii Heufler
Polyporus tinctorius Quél.
Polystictus hispidus (Bull.) Gillot & Lucand
Xanthochrous hispidus (Bull.) Pat.
Xanthochrous hispidus f. quercus Bourdot & Galzin
Xanthochrous hispidus f. salicum Bourdot & Galzin
Xanthochrous tinctorius (Quél.) Pat.
Hut: anfangs saftig, weicliscliwammig, grobfaserig, innen anfangs gelbbraun, später kastanienbraun, halbkreisförmig, polsterfürmig, hinten sehr dick, nach vorn gleichmässig verschmälert, meist 20 cm lang, G—12 cm breit, bis 8 cm dick, doch auch grösser. Oberfläche mit striegelig-filzigen, dunkel rostbraunen, zuletzt fast schwärzlichen Haarbüscheln bedeckt.
Lamellen: Röhren sehr lang, 1—3 cm, anfangs fast goldgelb, später rostfarben; Mündungen klein, rundlich, gleichfarben.
Fleisch:
Stiel:
Vorkommen: An Stämmen verschiedener Laubbäume, am häufigsten an Apfelbäumen, denen er, da das Mycel ausdauert und alljährlich vom Juli an wieder neue Fruchtkörper bildet, sehr schädlich wird.
Sporen: Sporen ellipsoidisch oder fast kugelig, mit kastanienbrauner, dicker, glatter Membran.
Speisewert:
essbar
Für volle Auflösung bitte auf da Bild klicken:
|
|
Bild 2 © (2) Jens H. Petersen/MycoKey
Abmessungen:
Hut
Hutform:
 ausgebreitet, flach
ausgebreitet, flach
 ohrförmig, zungenförmig, muschelförmig
ohrförmig, zungenförmig, muschelförmig
Hutoberfläche:
 matt
matt
 faserig, schuppig, haarig, borstig
faserig, schuppig, haarig, borstig
 wollig, grobschuppig, grobfaserig
wollig, grobschuppig, grobfaserig
Hutrand:
 glatt
glatt
 flockig, faserig oder überhängend
flockig, faserig oder überhängend
Hutfarbe:
 orange, rot, pink
orange, rot, pink
 hellbraun, braun, gelbbraun, rotbraun,
hellbraun, braun, gelbbraun, rotbraun,
Lamellen bzw. Röhren
Lamelen bzw. Röhren:
 Röhren
Röhren
Lamellenfarbe:
 creme, ocker
creme, ocker
 gelb
gelb
 orange, rot, rosa, pink
orange, rot, rosa, pink
 hellbraun, braun, gelbbraun, rotbraun,
hellbraun, braun, gelbbraun, rotbraun,
Lamellen- bzw. Röhrenansatz und Form:
 Lamellen bzw. Röhren dicht, dicht gedrängt, eng aneinander
Lamellen bzw. Röhren dicht, dicht gedrängt, eng aneinander
Stiel und Stielbasis
Stielgröße:
Stiel und Farbe:
Stielkonsistenz
äStielform, Stielbasis
Stieloberfläche:
Ring:
Fleisch
 dick
dick
 weich, schwammig
weich, schwammig
 fest, hart, zäh
fest, hart, zäh
 Previous
Previous